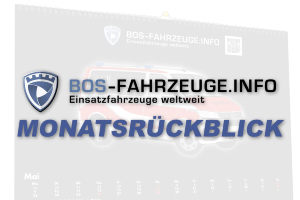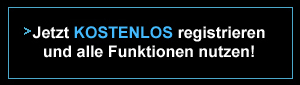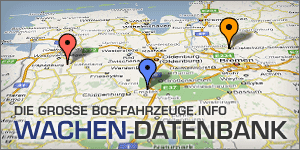Führende Kräfte des Provinzialfeuerwehrverbandes Hannover, der Landschaftlichen Brandkasse Hannover und der Stadt Celle hatten gegen Ende der 1920er Jahre die Notwendigkeit erkannt, die Ausbildung der Feuerwehrangehörigen zu verbessern, um eine bessere Wirkung ihrer Tätigkeit zu erreichen. Gemeinsam waren sie die „Geburtshelfer“ der Hannoverschen Provinzial-Feuerwehrschule in Celle, die im April 1931 ihren Dienstbetrieb aufnahm. Erster Schulleiter war der Kommandant der FF Celle, Walter Schnell.
1928 oder 1929 hatte Schnell ein Praktikum bei der Berliner Feuerwehr durchgeführt und die dort praktizierte Dreiteilung des Löschangriffs mit Feuerwehrmännern im Angriffstrupp, Leitertrupp und Schlauchtrupp kennen gelernt. Diese Taktik einer Berufsfeuerwehr entwickelte er für ländliche Wehren weiter und veröffentlichte sie erstmals 1934 in seinem Buch „Die Dreiteilung des Löschangriffs“. Schnell ging nunmehr von je zwei (oder notfalls mehr) Feuerwehrmännern im Angriffstrupp, Schlauchtrupp und Wassertrupp aus. Dafür entwarf er Konzeptionen für alle zur Verfügung stehenden Förderpumpen. Die Ende der 1930er Jahre noch vorhandenen ca. 20.000 Handdruckspritzen wurden ebenso abgehandelt wie die gerade aufkommenden Tragkraftspritzen, die Lafettenspritzen und die Fahrzeugpumpen.
Das Buch entwickelte sich zum Beststeller, es wurde mehrfach erneut aufgelegt, innerhalb weniger Jahre wurden weit über 10.000 Exemplare verkauft. Schnells Karriere wurde davon ebenfalls beflügelt: 1934 bestellte man ihn zum „Provinzialfeuerwehrführer der Provinz Hannover“, ab 01.01.1938 war er Leiter des neu geschaffenen „Amtes für Freiwillige Feuerwehren im Hauptamt Ordnungspolizei“, also der vorgesetzten Dienststelle aller Freiwilligen Feuerwehren im Deutschen Reich. Bei Kriegsende bekleidete er den Dienstgrad eines Generalmajors der Feuerschutz-Polizei.
Der Feuerwehrhistoriker Dieter Jarausch schrieb 2011 über Schnell: „Sein Verdienst um das deutsche Feuerwehrwesen war zweifelsfrei, das Berliner System der Dreiteilung ausgebaut, universell verwendbar und vor allem deutschlandweit durchgesetzt zu haben.“ Ab 1938 war diese Art des Löschangriffs im ganzen Reich die vom „Amt für Freiwillige Feuerwehren“ per Erlass verbindliche vorgeschriebene Vorgehensweise einer Löschgruppe.
Ausgeführt wurde sie in der 1939 erschienenen Polizei-Dienstvorschrift Nr. 23 „Ausbildungsvorschrift für den Feuerwehrdienst“. Diese „PDV“ bzw. „AVF“ war an der nahe Berlin gelegenen Feuerwehrschule in Beeskow/Mark erarbeitet worden, einer der Kaderschmieden für Feuerwehroffiziere und Unterführer der damaligen Zeit. Ab 1940 wurde Beeskow außerdem Standortdienststelle der neu aufgestellten Feuerschutzpolizei-Regimenter.
In Beeskow lehrte u.a. ein zunächst weitgehend unbekannter Feuerschutzpolizei-Offizier aus Niedersachsen mit Namen Fritz Heimberg. Es ist davon auszugehen, dass er auf Anweisung von Schnell an der Erarbeitung der PDV 23 maßgeblich mitgewirkt hat. Im Laufe des Krieges machte Heimberg Karriere und wurde 1940 als Hauptmann d. FSchPol. Kommandeur der Feuerschutzpolizei-Ersatzabteilung in Beeskow und damit quasi Schulleiter. Gegen Kriegsende wurde er noch zum Major d. FSchPol. befördert.
Gemeinsam mit seinem Ausbildungsleiter, Meister d. FSchPol. Waldemar Fuchs, erarbeite er einen Ausbildungsleitfaden zur PDV 23, der Anfang 1944 als „Die Ausbildung der Feuerschutzpolizei“ erschien. Dort setzten die beiden Feuerwehrmänner das von Walter Schnell eingeführte System des dreiteiligen Löschangriffs in die Praxis um. Das Buch fand bei der obersten Feuerwehrführung – vor allem beim Generalinspekteur der Feuerlöschpolizei, Generalmajor d. FSchPol. Hans Rumpf – derartigen Gefallen, dass im September 1944 per Runderlass festgelegt wurde, neben der eigentlichen PDV 23 nur das Buch „Heimberg-Fuchs“ für Ausbildungszwecke nutzen zu dürfen. Damit gehören die Vorschrift bzw. ihre Erklärung zu den grundlegenden Werken der deutschen Feuerwehrgeschichte.
Mit dem Ende der Diktatur war die nationalsozialistische Polizei-Dienstvorschrift selbstverständlich nicht mehr gültig, der „Heimberg-Fuchs“ war aber (z.T. mit Freigabestempel der alliierten Dienststellen versehen, ansonsten bereits 1947 in einer ersten Neuauflage) weiterhin die Ausbildungsgrundlage. Selbst in den 1970er Jahren wurde das Buch noch aufgelegt, inzwischen herausgegeben von Heimbergs Sohn Dieter, der als Berufsfeuerwehrmann in Oldenburg tätig war. Bis in unsere Zeit werden inoffizielle Wettkämpfe der Freiwilligen Feuerwehren nach den dort festgeschriebenen Regeln durchgeführt, sogar die heute gültige Feuerwehrdienstvorschrift FwDv4 zeigt noch Elemente dieses über 70 Jahre alten Ausbildungswerks.
Nach Kriegsende wurde Fritz Heimberg (jetzt als Oberbrandrat) von der britischen Besatzungsmacht sofort wieder als Fachmann benötigt und im Juli 1945 zum „Inspekteur des Feuerlöschwesens in der Provinz Hannover“ ernannt. Nach Gründung des Landes Niedersachsen wurde er 1946 dessen erster Landesbranddirektor.
Wie bereits in anderen Teilen der Artikelserie dargestellt, wurden in der Nachkriegszeit vor allem Tanklöschfahrzeuge von den Feuerwehren geordert. Heimberg als von Schnell beeinflusster Anhänger der „reinen Lehre“ befürchtete nun, dass durch die Staffelbesatzung der Tanklöschfahrzeuge die Dreiteilung des Löschangriffes unterlaufen werden könnte. Er wollte auf jeden Fall verhindern, das statt Löschgruppenfahrzeugen Staffeltanker beschafft wurden. Damit distanzierte er sich deutlich von den Vorstellungen seines hessischen Kollegen Noehl, der eine Mischung aus Löschgruppenfahrzeug und Tanklöschfahrzeug befürwortete.
Für Heimberg (und die meisten altgedienten Feuerwehrführer seiner Zeit) waren Tanklöschfahrzeuge lediglich Ergänzungseinheiten. Dass derartige Bedenken nicht völlig aus der Luft gegriffen waren, hat die weitere Entwicklung im Brandschutzbereich gezeigt. Viele Feuerwehren – vor allem mit teuren hauptamtlichen Kräften – rücken heute im Erstangriff maximal in Staffelstärke aus.
Heimberg nutzte seine Stellung und erreichte im Innenministerium, dass in Niedersachsen Tanklöschfahrzeuge nur noch dann vom Land bezuschusst werden konnten, wenn sie lediglich über eine Truppbesatzung verfügten. Den Kommunen blieb also im Regelfall gar nichts anderes übrig, als auf die Staffelbesatzung zu verzichten. Mit derartig abgespeckten Fahrzeugen war kein selbstständiger Löschangriff mehr möglich. Heimberg hatte sein Ziel erreicht.
Bei der Entscheidung gegen die Staffeltanker hatte er auch noch weitere gute Argumente ins Feld führen können: Der Verzicht auf eine Staffelkabine und drei weitere Feuerwehrmänner ließ einen von 2.400 auf 2.800 Liter vergrößerten Wassertank zu. In den 1960er Jahren steigerte sich das bei stärkeren Fahrgestellen auf bis zu 3.400 Liter Wasser. Das bewährte sich vor allem in den ausgedehnten Wald- und Heidegebieten des Landes. Wegen der nun verwendbaren serienmäßigen Kabine lagen die Kosten außerdem deutlich unter denen für ein Staffeltanklöschfahrzeug. Diese beiden Argumente überzeugten auch einzelne Feuerwehren außerhalb Niedersachsens, die ebenfalls TLF 16-T beschafften. Allerdings blieb deren Zahl sehr gering.
Fälschlich werden die TLF 15-T und TLF 16-T gelegentlich als Niedersachsen-Tanker bezeichnet. Das ist aufgrund der Geschichte zwar verständlich, aber faktisch falsch. Bestimmungen für TLF 16-T waren offiziell in den bundeseinheitlichen Vornormen und Normen für Feuerwehrfahrzeuge enthalten. Erst später gab es nur für das Land Niedersachsen gültige „Technische Weisungen“, die Anforderungen an Tanklöschfahrzeuge TLF 8 mit vergrößertem Wassertank und später die TLF 8-W definierten. Das waren die wirklichen Niedersachsen-Tanker.
In diesem Zusammenhang muss noch erwähnt werden, dass Landesbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen – wie in anderen Bundesländern üblich – in Niedersachsen unbekannt waren und sind. Alle „Steuerungsmaßnahmen“ wurden nur über „Technische Weisungen“ und die Gewährung von Zuschüssen aus der Landeskasse geregelt.
Neben Magirus-Fahrgestellen (natürlich mit Aufbauten aus dem eigenen Hause) war es vor allem der Mercedes-Benz Langhauber, der bis zum Modellwechsel als Basis für Tanklöschfahrzeuge mit Truppbesatzung genutzt wurde.
Anfangs hatte man sich an den bayerischen Richtlinien für TLF 16 orientiert. Der Allradantrieb, verbunden mit einem Radstand von 3.600 mm, führte zu hervorragenden Geländeeigenschaften. Wie bei den bayerischen TLF 15 war auch beim TLF 15-T ein Schnellangriffsschlauch aus formbeständigem Material im Geräteraum G4 untergebracht Im vorderen Bereich des Aufbaudaches wurde in der Regel ein Wendestrahlrohr montiert, das auch während langsamer Fahrt von einem Feuerwehrmann bedient werden konnte. Dieser stand dann in einer Mulde im Aufbau.

Brandbekämpfung über das Wendestrahlrohr eines TLF 15-T, hier gezeigt am Beispiel des Verdener Fahrzeugs (s.u.).
Wichtigster Aufbauhersteller bei Mercedes-Fahrgestellen war wieder einmal Metz. Von Anfang an wurden für diese Tanklöschfahrzeuggattung Ganzstahl-Aufbauten verwendet. Wie schon bei den ersten TLF 15 nach bayerischen Vorschriften, kamen die ersten TLF 15-T noch mit zwei am Heck angeordneten Standplattformen für zusätzliche Feuerwehrmänner daher. Damit wurde zum einen Heimbergs Absicht teilweise unterlaufen, zum anderen dürften die Fahrzeuge an der Grenze ihrer Nutzlast gelegen haben. Wegen der Gefahren für die nur mit ihrem Hakengurt gesicherten Mitfahrer am Heck wurde diese Bauweise schnell wieder verlassen, die Standplätze durften nicht mehr genutzt werden.

TLF 15-T, Mercedes-Benz LAF 3500/36, Metz, 1954, FF Verden, als Oldtimerfahrzeug erhalten. Für der Fahrt wurde das Wendestrahlrohr üblicherweise umgeklappt, um Beschädigungen zu vermeiden.

Standplattformen und Haltegriffe am Heck des TLF 15 der FF Verden. Die Pumpenraumtür ist als Klappe ausgeführt worden und wird beim Öffnen teilweise in den Aufbau eingeschoben.

Vorführung des Verdener TLF 15-T auf einem Oldtimertreffen 2010 in Dibbersen bei Hamburg. Die moderne Feuerwehrkleidung steht in deutlichem Gegensatz zum historisch korrekten, im öffentlichen Straßenverkehr aber längst verbotenen Mitfahren auf den Standflächen am Heck.
Die Metz-Aufbauten der Baujahre ab 1955 orientierten sich an denen der parallel gefertigten Staffeltanker. Die Türenanordnung sah wie bei ihnen vorne und hinten auf jeder Seite je einen Geräteraum vor, wegen der geringeren Besatzung aber mit weniger Ausrüstungsgegenständen. Der Platz über der Hinterachse wurde für einen relativ langen Stahltank genutzt.

TLF 16-T, Mercedes-Benz LAF 311/36, Metz, Baujahr 1956, FF Buxtehude, Zug 1. Das Fahrzeug stand bis 1999 im Einsatzdienst (die letzten Jahre im 2. Abmarsch) und wird heute als Oldtimer erhalten.

Blick auf das Heck des Buxtehuder Tanklöschfahrzeugs. Da keine Standplattformen im Weg sind, können die Türen zur Seite hin geklappt werden.
Die TLF 16-T verkauften sich in Niedersachsen ganz hervorragend. Genaue Zahlen waren nicht zu ermitteln, man muss aber von mehreren Dutzend Fahrzeugen mit Metz-Aufbauten ausgehen. Zum Teil unterschieden sie sich in Details. So sind z.B. am ehemaligen Tanklöschfahrzeug der FF Burgdorf (siehe auch Titelbild dieses Artikels) auf der Beifahrerseite vier B-Stutzen zu sehen. Vermutlich dient der hinterste nicht als Abgang, sondern zum Befüllen des Tanks aus Hydranten oder anderen Fahrzeugen.

TLF 16-T, Mercedes-Benz LAF 311/36, Metz, Baujahr 1958, geliefert an die FF Burgdorf, abgegeben 1974 an die Ortsfeuerwehr Heessel. Nach der 1992 erfolgten Rückgabe wurde es von Angehörigen der OF Burgdorf wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt.
Genau wie bei Staffel-Tanklöschfahrzeugen und Löschgruppenfahrzeugen bot Metz ab etwa 1958 auch bei TLF 16-T als Verschmutzungsschutz eine Verkleidung der seitlichen Abgänge gegen Aufpreis an. Besonders bewährt haben dürfte sie sich nicht, da sie einen deutlichen Konstruktionsfehler hatte: Die Abdeckung klappte nach unten weg, und offenbar war die Verriegelung nicht auf Dauerbelastung ausgerichtet. An den folgenden Bildern ist das gut zu sehen, auf der Beifahrerseite hing die Klappe schon ein Stück zu tief, auf der Fahrerseite fehlte sie beim Fototermin.

TLF 16-T, Mercedes-Benz LAF 311/36, Metz, Baujahr 1958, Vollverkleidung der seitlichen B-Abgänge, FF Lauenburg / Elbe. Auf auch der schleswig-holsteinischen Elbseite wusste man so ein Tanklöschfahrzeug mit Truppbesatzung zu schätzen, es ist bis heute im Einsatzdienst.

Fahrerseite des Lauenburger Tanklöschfahrzeugs mit fehlender Abdeckklappe über dem seitlichen B-Abgang.
Etwas sinnvoller war diese Problematik am TLF 16-T der FF Emstek gelöst. Hier wurde die Klappe nach oben geöffnet, im Fahrzustand wirkten also Schwerkraft und Verriegelung in dieselbe Richtung. Es soll sich hinter der Klappe sogar ein fest gekuppelter B-Schlauch befunden haben. Ob diese Konstruktion von Anfang an so geplant oder ein Eigenumbau der Wehr war, konnte nicht festgestellt werden. Den B-Anschluss zur Tankbefüllung hatte man übrigens nicht mit verkleidet, da er vermutlich schlicht nicht mehr hinter die Klappe gepasst hatte.

TLF 16-T, Mercedes-Benz LAF 311/36, Metz, Baujahr Ende 1958, FF Emstek.
Sehr wenige TLF 16-T lieferte Metz auch auf Straßenfahrgestellen aus, was sicher daran lag, dass gerade die hervorragenden Geländeeigenschaften, verbunden mit dem großen Wassertank, den hohen Einsatzwert dieser Fahrzeuge ausmachten. Bekannt sind derartige TLF 15-T von der FF Lingen (später umgesetzt zur OF Bramsche bei Lingen) und aus Freiburg im Breisgau, beide ausgeliefert 1955. Im Bild zeigen können wir sie leider nicht.
Abschließend sei bemerkt, dass Metz diesen Aufbautyp nahezu unverändert auch noch einige Jahre bei den nachfolgenden Kurzhaubern von Mercedes-Benz-verwendet hat.
Die Firma Graaff in Elze verfügte Mitte der 1950er Jahre über hervorragende Kontakte zum Landesbranddirektor Heimberg, man hatte sich gegenseitig bei der Entwicklung von LF 8 und TLF 8 für die ländlichen Feuerwehren unterstützt. Was lag also näher, als auch für den niedersächsischen Markt TLF 16-T zu produzieren? Erstaunlicherweise ist das aber nicht in dem Umfang passiert, wie man es erwarten könnte. Ein Grund dürften nicht ausreichende Kapazitäten im Werk in Elze gewesen sein.
Graaff-TLF wiesen zudem eine Besonderheit auf, die eventuell nicht den nötigen Anklang bei den Feuerwehren fand: Im Stahlgerippe des Aufbaus wurden aus Gummi bestehende so genannte Elastik-Tanks an den Ecken aufgehängt. Entwickelt worden war diese Neuerung zusammen mit der Fa. Continental aus Hannover. Man versprach sich davon eine geringere Empfindlichkeit der Tanks gegen Stoß, Druck und Verwindung. Allerdings wurden die Gummibehälter im Bereich der Aufhängungen massiv belastet. Üblich waren Tankgrößen von maximal 1.000 Litern, so dass in ein TLF 16-T drei Tanks eingebaut wurden. Sie mussten untereinander und mit der Pumpe verbunden werden, was aber offensichtlich keine Probleme bereitete. Nur sehr selten wurde von Tankabrissen an den Halterungen oder von Tankplatzern wegen Überfüllung (trotz Überlauf) berichtet. Die Firma Arve nutzte diese Tankbauart übrigens ebenfalls in späteren Jahren.
Aufgrund dieser Tankkonstruktion war die Türanordnung eine andere als bei Metz. Je Seite gab es drei Geräteräume, deren Gestaltung sich im Laufe der Produktionsjahre aber änderte. Die Pumpen steuerte jeweils AMAG-Hilpert bei. Ungefähr ein halbes Dutzend TLF 16-T mit Graaff-Aufbauten sind bestellt geworden, ausnahmslos auf Allrad-Fahrgestellen. Alle gingen in den Nordwesten Niedersachsen, den späteren Regierungsbezirk Weser-Ems.

TLF 16-T, Mercedes-Benz LAF 311/36, Graaff, Baujahr 1955, beschafft von der FF Lastrup, Ende der 1980er Jahre ausgemustert und von einem Wehrmitglied übernommen. Vorne an der Aufbauseite und in der Mitte waren Doppeltüren vorhanden, hinten eine Einzeltür. Das am Heck nach hinten gezogene Blech legt den Verdacht nahe, dass hier auch Standplätze angeordnet waren. Tatsächlich wurden aber nur ausklappbare Aufstiegsleitern dadurch geschützt.

TLF 16-T, Mercedes-Benz LAF 311/36, Graaff, Baujahr 1957, geliefert an die FF Emsbüren, heute dort Traditionsfahrzeug. Hier gibt es nur für die Geräteräume 5 und 6 Doppeltüren, ansonsten werden Einzeltüren genutzt.

TLF 16-T, Mercedes-Benz LAF 311/36, Graaff, Baujahr 1959. Bestellt und in Dienst gestellt wurde das Fahrzeug von der FF Essen in Oldenburg. Nach der Ausmusterung erwarb es der Löninger Holzschutzmittelhersteller Remmers Chemie für seine neu aufgestellte Werkfeuerwehr. Die Türanordnung entsprach dem Emsbürener TLF 16-T, das fehlende Trittbrett gewährte aber eine größere Geländetauglichkeit.

TLF 16-T, Mercedes-Benz LAF 311/36, Graaff, Baujahr 1960. Dieses Fahrzeug verkörpert die letzte von Graaff produzierte Version des TLF 16-T. Nach seiner Dienstzeit bei der OF Kirchhatten (Kernort der Gemeinde Hatten) erwarb es der nahegelegene Flugplatz Oldenburg-Hatten für seine Betriebsfeuerwehr. Der Verbleib ist unbekannt. Ein nahezu baugleiches TLF16-T war bei der FF Ahlhorn im Dienst, es wurde später an den Flugplatz Nordhorn-Klausheide abgegeben.
Gegen Ende der Produktionszeit der Langhauber-Fahrgestelle stieg – wie bereits dargestellt – auch die Firma Ziegler in diesen Markt ein. Deren TLF 16-T auf Mercedes-Benz LAF 311/36 sind noch seltener als Graaff-Aufbauten. Auch hier handelt es sich um reine Stahlaufbauten. Die Tank- und Türanordnung entspricht den Metz-Fahrzeugen, weshalb sie auch gerne mit diesen verwechselt werden. Bekannt geworden sind nur Allradfahrzeuge.

TLF 16-T, Mercedes-Benz LAF 311/36, Ziegler, Baujahr 1958, FF Lemförde. TLF 16-T, Mercedes-Benz LAF 311/36, Ziegler, Baujahr 1960, FF Dillingen/ Saar, Löschbezirk Diefflen. Es ist vermutlich das einzige Ziegler-TLF 16-T mit Schlauchkästen auf den Trittbrettern.
TLF 16-T, Mercedes-Benz LAF 311/36, Ziegler, Baujahr 1960, FF Dillingen/ Saar, Löschbezirk Diefflen. Es ist vermutlich das einzige Ziegler-TLF 16-T mit Schlauchkästen auf den Trittbrettern.

TLF 16-T, Mercedes-Benz LF 311/36, Ziegler, Baujahr 1960, Herkunft unbekannt, erworben von einem LKW-Händler, heute Traditionsfahrzeug der FF Clausthal-Zellerfeld. Es entspricht weitgehend einem ursprünglich bei der Feuerwehr vorhandenen TLF 16-T, das aber nach seiner aktiven Dienstzeit zum Streufahrzeug umgebaut und später verschrottet wurde.
(wird fortgesetzt)
Text: Klausmartin Friedrich
Bilder: Stefan Fleischer, Klausmartin Friedrich, Godehard Gottwald, Heiner Lahmann, Markus Lauer
Literatur (u.a.):
Daimler-Benz AG (Hrsg.): Brandschutz mit Stern: Die Geschichte der Mercedes-Benz Feuerwehrfahrzeuge und ihrer Vorgänger (1888-2002); Stuttgart, 2007.
Daimler-Benz AG (Hrsg.): Transport mit Traktion: Allradgetriebene Lkw seit 1945; Stuttgart, 2011.
Jarausch, Dieter: Biografie Walter Schnell;
in: Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V., Referat 11 Brandschutzgeschichte (Hrsg.); Münster, 2011
Jarausch, Dieter: Die Fachzeitschriften "Die Feuerlösch-Polizei" bzw. "Deutscher Feuerschutz" waren von 1937 -1945 nacheinander staatliches Zentralorgan des Feuerlöschwesens im Deutschen Reich;
in: Klaedtke, B. u. Thissen, M. (Hrsg.): Feuerwehrchronik; Grevenbroich u. Rommerskirchen, Heft 2/2010.
Thorns, Jochen: Graaff – innovative Feuerwehrfahrzeuge aus Elze;
in: Jahrbuch Feuerwehrfahrzeuge 2015; Brilon, 2014.